Dorcas Müller
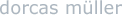
Das folgende Interview wurde im Rahmen von kFP/02 einem Forschungsprojekt des Künstlerhauses Dortmund geführt. Untersucht werden die Transfer- und Integrations-Leistungen künstlerischer Tätigkeit im Kontext von Wissenschaft, Politik und Wirtschaft sowie deren Verhältnis zur gesellschaftlichen Lebenspraxis.
Die künstlerische Arbeit von Dorcas Müller (geb. 1973) beschäftigt sich mit Schnittstellen am menschlichen Körper, der Blutegel ist seit 1998 ihr wichtigstes Arbeitsmaterial im Bereich performatives Video und Fotografie. 2000 stieß sie auf die Neurochipforschung von Prof. Peter Fromherz. Der erste funktionsfähige Neurochip, Schnittstelle zwischen technischem und organischem Material, entstand zu Beginn der 90er Jahre in seiner Forschungsabteilung für Membran- und Neurophysik im Max-Planck-Institut in Martinsried/München, unter der Verwendung von Siliziumchips und lebendigen Blutegelhirnzellen. Mit einem Durchmesser von 60 Mikrometern sind diese so genannten „Retziuszellen“ für Zellmaßstäbe außergewöhnlich groß und waren deshalb besonders dafür geeignet.
Im Mai 2000 fuhr Dorcas Müller zu einem Gespräch mit Prof. Fromherz nach Martinsried. Das spontane, aus dieser Begegnung resultierende, Angebot in seiner Abteilung und mit seinem Equipment Arbeiten herstellen zu können, nutzte Sie 2001/2002 ein Jahr lang.
Die dort entstandenen Videos und Fotografien bewegen sich an den Schnittpunkten des physisch realen Anschlusses des menschlichen Körpers an das digitale Netz. Es dominiert immer der leibliche, performative Akt den bildnerischen Inhalt und rückt dadurch den Körper wieder in das Zentrum der wissenschaftlichen Interessen. Die Differenz ihrer mitgebrachten Vorstellungen und Wahrnehmungen erzeugt im performativen Video ein verändertes Bild des dortigen wissenschaftlichen Modells. Zum Beispiel sind im Video „Die Erschaffung des Neuros“ die Komponenten Chip - Blutegelhirnzelle - Mensch in die unmittelbar zu erfahrende Welt übersetzt. Ein lebendiger Blutegel pumpt Information zwischen einem (echten) Neurochip und einer menschlichen Hand, doch die Verbindung ist nicht von Dauer...
Die Tragbreite ihrer Arbeit ist nicht nur ein ästhetisch, formalistisches Moment, sondern bewegt sich auch auf sozialer und wissenschaftlicher Ebene: durch interessierte und ausdauernde Intervention hat sie sich Zugang und künstlerische Handlungsfreiheit in der Neurochipforschung des Max-Planck-Instituts erschlossen.
Das Interview führte Bettina Reichmuth im Juli 2002.
B. Reichmuth: Du arbeitest seit Mai 2001 mit der Forschungsabteilung für Membran- und Neurophysik des MPI in Martinsried zusammen. Woher stammt Dein Interesse für Naturwissenschaft?
D. Müller: Ich interessiere mich für die sinnliche, triebhafte Motivation, die den Menschen zum Forschenden macht und die Naturwissenschaft ist nur ein Teilbereich davon, der besonders straff organisiert ist. Sozusagen ein Separé, das nur dazu da ist, mit den Einzelteilen der Welt in Kontakt zu treten. Eine besonders dichte Atmosphäre, in der es für mich viel zu sehen gibt.
B.R.: Gab es Hürden für diese Zusammenarbeit?
D.M.: Um von außen in die Forschung eindringen zu dürfen, muss man zumindest einmal beweisen, dass man ein mindestens ebenso triebhaftes, wenn auch fachfremdes Anliegen hat, dabei zu sein. Das wurde mir als Künstlerin dann auch geglaubt.
B.R.: Wer gab dir grünes Licht für Deine Arbeit am MPI?
D.M.: Einlass zu seiner Abteilung gewährte mir Prof. Peter Fromherz selbst. Das war ein Glücksfall, da er grundsätzlich an Austausch sehr interessiert ist und beispielsweise auf der Abteilungshomepage sogar seine persönliche E-mail-Adresse angibt. Auf diesem Wege habe ich ihn das erste Mal kontaktiert. In der Zeit, als ich da war, arbeiteten noch zwei andere Gäste dort, ein Psychologe und eine Restauratorin. Nun verbindet Fromherzens Abteilung an sich bereits Biochemie und Physik, ein in der Forschung ebenfalls unübliches Unterfangen, was diese Aufgeschlossenheit sicherlich mitbegründet.
B.R.: Wie sind die Reaktionen auf Dich als Künstlerin im MPI Martinsried? Wie gesprächsbereit sind Deine Kollegen?
D.M.: Die erste Frage, die mir gestellt wurde war, wo ich denn meine Staffelei versteckt hätte! Die nächste, warum ich denn bei diesem schönen Wetter nicht lieber in die Pinakothek ginge, anstatt mir die für mich bestimmt langweilige Arbeit in der Abteilung anzusehen.Die erste Zeit musste ich wirklich diplomatische Fähigkeiten entwickeln, konnte dann aber von meinem Interesse überzeugen, konnte herausfinden, wer wofür zuständig war, da ich ja für alle Aktivitäten in den Räumlichkeiten und mit den Geräten die nötige Kompetenz erwerben musste. Zudem wollte ich den normalen Betrieb keinesfalls stören, sondern mich unsichtbar einfügen und beobachten. Das ist besser, als jedes Mal einen Ausnahmezustand hervorzurufen. Dazu muss man auch einschätzen, wann man sich besser zurückhält, da die Konzentration, mit der dort gearbeitet wird, meistens sehr hoch ist. Dass ich die Zeit in diesem Sinne investiert habe, belohnte mich mit einem regen Kommunikationsfluss.
B.R.: Du scheinst mit Deinen Foto- und Video-Arbeiten an eine Generation von Naturwissenschaftlern zu erinnern, die nicht nur mit Materie als Forschungsmaterial arbeiteten, sondern auch „Naturphilosophen“ waren, die hinter den messbaren Dingen eine tiefere Bedeutung und Antworten auf erkenntnistheoretische Fragen vermuteten. Hast Du den Eindruck, der Haltung der Wissenschaftler, mit denen Du arbeitest, fehlt heute dieser Ansatz?
D.M.: Ich denke eher, dass diese Qualitäten zur Stunde nicht sehr gefragt sind. Schon allein die Tatsache, dass mein großes Interesse an der Forschung zunächst mit Staunen und Unverständnis erwidert wurde, zeigt doch, dass es selten vorkommt, dass jemand von außerhalb wissen will, was es dort zu sehen gibt. Es wird einfach nicht gefragt. Natürlich ist viel Fruchtbares vorhanden, man hat es ja mit Menschen zu tun. Es ist ein unermesslicher Luxus geworden, sich Zeit zu nehmen um nachzufragen, oder sich Zeit zu nehmen, um seinen Überfluss weiterzugeben. Wenn man für diesen Luxus bereit ist, auf andere Dinge zu verzichten, ist alles möglich.
B.R.: Vereinfacht gesagt: Wissenschaft erforschte ursprünglich die Welt, damit die Menschheit sie besser verstehen und für sich nutzen, „sich untertan machen“ konnte. Mittlerweile greift Wissenschaft massiv in natürliche Reproduktionsvorgänge ein und will Natur zum Vorteil des Menschen verändern. Damit untersucht sie nicht nur die Wirklichkeit, sondern stellt diese regelrecht selbst her. Du sprichst von Deinem Interesse an den Strategien, mit denen versucht wird, einen als mangelhaft empfundenen Körper zu überwinden. Wie empfindest Du selbst diese Strategien - Bewusstseinserweiterung durch Drogen, Schönheitsoperationen, Genmanipulation? Drängt Dich dieses Vordringen neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse in unsere unmittelbare Lebenswelt, Dich mit Wissenschaft zu beschäftigen?
D.M.: Mein persönlicher Eindruck ist durchaus nicht, dass der Mensch außerhalb der Natur steht und diese mit seinem Tun ständig aus dem Gleichgewicht bringt. Man könnte genauso gut einer Ameise erzählen, es sei nicht gut Haufen zu bauen.Die Objektivität, mit der die Wissenschaft und genauso die Kunst die Welt betrachtet, ist eine konstruierte. Sie stellt sich scheinbar über die Dinge, um sie zu überblicken. Weil der Mensch das natürlich nicht wirklich tun kann, bastelt er lauter kleine übersichtliche Modelle. Dabei kann aber nur entstehen, was die Bausteine der Welt ihrem Wesen nach zulassen, was die Natur und ihre Gesetze zulassen. Was dabei entsteht, kommt allenfalls uns Menschen häufig sehr künstlich vor, der Natur ist das aber egal, denn das Modell drückt nur eine Form ihrer Möglichkeiten aus. Und mit diesem Phänomen spielt meine Arbeit. Ich nutze die Erschrockenheit des Menschen über seine eigenen Produkte. In gewisser Weise scheitert der Mensch an der Mächtigkeit der Natur und nicht umgekehrt. Es ist reizvoll, diese Produkte wieder gemeinsam mit dem Menschen ins Bild zu rücken. Es fällt überhaupt auf, dass in der Bilderwelt der Wissenschaft meistens High Tech zu sehen ist; der Mensch (als Körper), dem zu Ehren und zur Hilfe all das erfunden wurde, hat sich aus diesen Bildern verabschiedet, als wäre er ein Schandfleck.
B.R.: Man könnte Deine Arbeiten, die über Schnittstellen des Körpers und naturwissenschaftliche Forschung unter Einsatz des eigenen Körpers reflektieren, vorschnell in die Nähe von Künstlerinnen wie Orlan (ihre Operationen bringen den blutigen Körper als Fleisch auf die Bühne) oder auch Mona Hatoum (sie führte 1994 in ihrer Arbeit Corps Etranger eine Kamera in ihren Körper ein und thematisierte damit die vollständige Durchdringung durch wissenschaftliche Apparate und die Verletzbarkeit des Organismus) bringen. Wie stehst Du zu diesen zwei sehr unterschiedlichen Künstlerinnen, denen es offensichtlich auch um die Frage der Identität in Zusammenhang mit künstlichen Eingriffen geht?
D.M.: Das ist ein spannender Vergleich, da bei beiden Künstlerinnen die letzte Frage immer bleibt: ob man seinen Körper aktiv zur Intervention anbietet oder sogar sich selbst manipuliert oder ob man passiv vom „Fremden“ vereinnahmt wird. Ich vergleiche das gerne mit allen Facetten des Sado-Masochismus - solange nicht Krieg oder unerwünschte Gewalt oder der drohende Tod mit im Spiel sind, ist man einverstanden mit dem, was geschieht. Ob man sich dabei etwas antut, was man doch nicht wirklich verkraftet, ist eine andere Geschichte, man verändert sich ja ständig. Zum Beispiel wächst die Bereitschaft, etwas aus Liebe zu tun, oder weil man beobachtet wird, von Menschen, Ärzten, Angehörigen oder medialen Linsen jeglicher Form.Ich selbst nutze die Linse als Anlass etwas zu tun, das ich mir ohne Grund nicht mehr zugestehe. Es ist für mich schwierig, in den Tag hineinzuexperimentieren, ohne mehr Kind zu sein. Im Gegensatz dazu gibt es auch heute noch Menschen, die sich gegen gängige Behandlungsmethoden entscheiden, gerade wenn der sichere Tod droht. Man entscheidet selbst was man sich antut. Deshalb ist Orlans Arbeit so unglaublich stark: man möchte sich das eigentlich nicht bewusst machen.
B.R.: Diese Rückführung auf das eigene, weibliche, organische Material - Du selbst benutzt Dich als Material, betreibst eine Art ästhetischen Experiments mit Dir selbst. Ist diese Person in Deinen Filmen austauschbar?
D.M.: Du sprichst die Frage nach der Authentizität an. Identitäten fürs Bild können natürlich unendlich manipuliert werden. So einfach das klingt, aber gerade bei meiner Arbeit müsste ich wohl weit laufen, um jemanden zu finden, der mir diese säftezehrende Aufgabe abnehmen möchte. Ich möchte ja keine „Snuffmovies“ drehen. Solange ich meinen bildnerischen Ansprüchen genüge, möchte ich mich selbst so richtig gut ausnutzen. Oder möchtest Du bei Gelegenheit einspringen?
B.R.: Ein Charakteristikum Deiner Arbeiten ist meines Erachtens, dass trotz der Zusammenarbeit mit Naturwissenschaft das Ergebnis sehr sinnlich ausfällt und die Entstehungsgeschichte der Videos nicht klar erkennbar ist. Wie wichtig ist Dir das?
D.M.: In meinen Arbeiten verbinde ich, was eigentlich zusammengehört, in einer Form, die den menschlichen Körper als das zeigt, was er ist: Als einen hochkomplexen, verletzlichen, organischen Leib, der Rituale und Umgangsformen entwickelt, um sich dem, was ihn umgibt, überhaupt nähern zu können, es begreifen zu können. Und das Wichtigste ist, dass er sehr langsam dabei ist, er braucht Zeit, um sich an neue Dinge zu gewöhnen, und gerade seine Lebenszeit ist zugleich das Kostbarste, was er besitzt. Trotz aller Strategien und Hilfsmittel sind es diese Dinge, mit denen man sich tagtäglich und letztlich befassen muss. Ich finde die Scham über die eigene Unzulänglichkeit schlimm. Wozu sich doppelt bestrafen?
B.R.: Das MPI arbeitet mit Blutegeln, weil sie besonders große Gehirnzellen haben, die sich für Forschungszwecke eignen. Du bezeichnest Dich selbst in Deinem Arbeitsverhalten als Blutegel - damit greifstDu das dortige Haupt-Versuchstier als selbstreferentielle Metapher auf. Du bist der Blutegel, der an der Forschung ansetzt - kannst Du das genauer erklären?
D.M.: Nun kam ich ja über den Blutegel zur dortigen Forschung. Ich fand den Blutegel, da ich ein bildnerisches Mittel suchte, um das Gegenteil von allen möglichen Arten von „Aufnahme“ zu beschreiben, sei es in Bezug auf diverse Stoffe, Information, Multimedia, was auch immer. Bildhaft, auf die Spitze getrieben, das genaue Gegenteil von intravenösem Konsum. So hatte ich schon einige Arbeiten mit Blutegeln gemacht, bevor ich überhaupt auf die Neurochipforschung des MPI kam. Dass ein Blutegel während eines Bisses in Wirklichkeit eine Vielzahl von Stoffen injiziert, um seinen Wirt zu pflegen, stellte sich erst nach eingehender Recherche zu diesen Tieren heraus. Der englische Wissenschaftler Roy T. Sawyer beschreibt den Blutegel als einen Arzneischrank des Menschen. Ein Wesen, das sich während seiner Evolution ausschließlich auf den Körper von Säugetieren spezialisiert hat. Ein Wesen, das man zuverlässig befragen kann, wenn man etwas über den Menschen wissen will. Man könnte auch sagen: Meine Parasiten sind die Einzigen, die sich wirklich für mich interessieren. In diesem Sinne bin ich im Max-Planck-Institut der freundliche Parasit. Wie ein Hund sitze ich unter dem Tisch des Wissenschaftlers und schnappe mir die besten Stücke.
B.R.: Oder etwas allgemeiner formuliert: Die Kunst ist neben der Philosophie eine der wenigen Disziplinen, die einen Vogelflug über die verschiedenen Wissenschaftsbereiche erlaubt. Damit ist sie in der Lage, Verknüpfungen herzustellen. Sicherlich ist damit die wachsende Popularität von zeitgenössischer Kunst verbunden. Interdisziplinäres Arbeiten wird überall angestrebt. Für wie realistisch hältst du diese Rolle von Künstlern?
D.M.: Das ist wohl von Fall zu Fall unterschiedlich. In meinem Fall wollte ich unbedingt in die Nähe der Forschung und war mir bewusst, dass sie mich überhaupt nicht braucht. Aber „die Forschung“, das sind natürlich eine Menge Menschen, die man auch stimulieren und begeistern kann, um Einlass gewährt zu bekommen. Bestimmte Pläne hielt ich also im Blick, während ich einen Teil meiner Kraft einsetzte, um spontan auf die dortigen Gegebenheiten zu reagieren. Dabei wollte ich auch gerne etwas machen, was für die Forscher interessant sein könnte - man kann ja auch dazugewinnen, wenn man Kompromisse zulässt. Jegliche Arbeit beschert einem Erfahrung, und man kann vieles wieder in die künstlerische Arbeit einfließen lassen.So machte ich schließlich eine 360° Animation von elektronenstrahlmikroskopischen Bildern einer Siliziumchipoberfläche, auf dem Nervenzellen in kleinen Käfigen sitzen. Solch einen räumlichen Eindruck von der Chipoberfläche hatte bis dahin noch keiner der Abteilung bekommen. Man muss so etwas vor Ort machen: Wie soll sonst das Bewusstsein entstehen, die Forschung könne von der Kunst profitieren? Ich lernte, mit dem Mikroskop umzugehen - das bildnerische Know-how brachte ich aus meinem Fachbereich mit. Das Springen zwischen den Disziplinen erlaubt mir, Komponenten zusammenzubringen, die sonst nie aufeinandertreffen würden. Diese Freiheit zu springen habe ich als Künstlerin, das ist mein Kapital. Diese träge Masse kann man schon überwinden. Man glaubt gar nicht, wie wenig Austausch da selbst zwischen den einzelnen Stockwerken eines Instituts stattfindet. Aber man muss sich zunächst aufdrängen.
B.R.: Im Aufeinandertreffen von Kunst und Wissenschaft geht man fälschlicherweise von einer Gleichberechtigung und einem beidseitigen Interesse aus. Zwei Wahrnehmungsweisen sind aber auch zwei Realitäten: die Wissenschaft als System mit hohem sozialen Status, gut verdienenden Forschern und einem weitgehend festgefügten Weltmodell auf der einen Seite, auf der anderen Seite der hinterfragende Künstler, akzeptierter Außenseiter und Grenzgänger der Gesellschaft, der meistens in einer unsicheren finanziellen Situation ist und einen Großteil seines Studiums mit Identitätsproblemen ringt. Nun geht der Künstler zum Wissenschaftler und die Situation ist doch eine eher ungleiche: Die Macht, das Geld und damit auch die Entscheidungsgewalt liegen eindeutig bei der Wissenschaft. Welche Eigenschaften künstlerischen Strategien wecken Deiner Meinung nach das Interesse und die Faszination der oft selbstgenügsamen Wissenschaft an der Kunst? Und was erhofft, auf der anderen Seite, der Künstler? Gehen diese Interessen zusammen, oder musstest auch Du Kompromisse eingehen?
D.M.: Es gab auch ein Projekt von dem Hirnforscher Dr. Ernst Pöppel, der Künstler aufforderte, bei ihm in der Forschung Arbeiten herzustellen. Das Problem war dabei, dass die Künstler nicht aus eigenem Interesse dorthin gepilgert waren. In diesem Fall war die Wissenschaft an der künstlerischen Arbeit interessiert, aber die Arbeiten blieben meist illustrativ. Damit muss sich dann die Wissenschaft abfinden, dass Kunst auf Kommando eben an Qualität einbüßt. Ich finde, die Wissenschaft sollte eher spontan und dann richtig gut und bewusst interessierte Künstler fördern. Ansonsten denke ich, dass auch auf dem kulturellen Sektor und dem Kunstmarkt extrem viel Geld unterwegs ist, welches recht konservativ eingesetzt wird. Angestellte in Museen verdienen nicht schlechter als Angestellte des MPI. Der Künstler, um dessen Produkte sich in der Kunst eigentlich alles dreht, ist einfach der Letzte in einer langen, langen Nahrungskette.
B.R.: Oberflächen: Du erwähntest, dass die Wissenschaft zunehmend mit Bildern Werbung betreiben muss, Strategien aus der Wirtschaft übernimmt. Was für eine Bildwelt ist das Deiner Einschätzung nach? Kann Kunst hier vielleicht auch anknüpfen?
D.M.: Nun ist die Wissenschaft ja auf Fördermittel angewiesen und muss ihre Arbeit einem Publikum vorstellen, welches nicht unbedingt dieselbe Sprache spricht. Wenn ein Forschungszweig gute Bilder anbietet, wird häufiger in der Presse darüber berichtet werden, was wiederum neue Gelder fließen lässt. Und Erfolg wird nicht zuletzt anhand der Anzahl der Publikationen gemessen. Das wissenschaftliche Bild ist wie alle Bilder ein konstruiertes. Das wissenschaftliche Bild von organischem Material ist beispielsweise meist durch High Tech generiert. Man sieht nicht eine Nervenzelle in ihrem Alltag, als arbeitenden triefenden Membransack, das ist ja auch gar nicht möglich. Man sieht ein aus dem Zusammenhang herausgelöstes Objekt, welches bereits tot ist und mit einem Verfahren mumifiziert und mit Gold beschichtet wurde. Nicht einmal das Bild ist wirklich fotografiert, sondern es ist ein mittels eines Elektronenstrahls berechnetes Relief. Das Antlitz der Zelle auf solch einem Bild ist ebenso wahrhaft wie das retuschierte Bild eines Stars auf einer Fernsehzeitschrift. Aber in jenem Fall beklagt man sich eben nicht, man möchte ja keine Pickel in der Illustrierten sehen, es reicht, wenn man sie selber hat. Und so dürfte es mit den wissenschaftlichen Bildern auch sein: es funktioniert, weil der Betrachter es gerne so sehen möchte. Und der Betrachter möchte, dass die Wissenschaft alles unter Kontrolle hat, das vermittelt ihm Sicherheit. Auf dem bildnerischen Sektor kann die Wissenschaft noch viel von der Kunst lernen!
B.R.: Für wie übertragbar hältst Du Deine Vorgehensweise in der Zusammenarbeit mit Naturwissenschaftlern? Bist Du ein Einzelfall, der Glück gehabt hat, oder erkennst Du nach der bisherigen Zeit bestimmte Denkstrukturen, auf die Du Dich als Künstlerin einstellen kannst und die es erlauben, zu einem produktiven wissenschaftlich-künstlerischem Dialog zu finden?
D.M: So mit offenen Armen aufgenommen zu werden ist sicherlich ein großes Glück gewesen. Aber ich muss zugeben, dass die Schwellenangst größer war, als die tatsächlichen Hindernisse. Was man tun muss, ist Zeit investieren und sich tatsächlich an Ort und Stelle begeben. Dort sein, den Kontakt wirklich herstellen. Wissenschaft ist etwas, das Menschen tun. Man kann diese Leute aufsuchen und sie belästigen!
B.R.: Kunst und Wissenschaft. Es gab bisher schon einige Ausstellungs- und Forschungsprojekte zu diesem Thema. Du selbst hast 2001 in München in der Lothringer13/Halle an der Ausstellung „Fiction and Science“ teilgenommen. Wie ist Dein Eindruck vom Umgang zwischen Kunst und Wissenschaft, von der Auswirkung dieser Projekte?
D.M.: Es ist sehr erfreulich, solche temporären Foren zu haben, auf denen die Ergebnisse kommuniziert werden können. Das erzeugt Aufmerksamkeit. Ich finde es wichtig, dass man nicht in ein Themenghetto abrutschen muss, sondern wieder in das Gesamte eintauchen kann. Sonst verspielt man die Chance, die die Reibung zwischen verschiedenen Bereichen nun einmal bringt. Es ist denkbar, dass solche Ausstellungen den Weg in die wissenschaftlichen Institute zurückfinden. Das würde den Austausch perfekt machen. Viele Institute verfügen über Räumlichkeiten, die oft sehr unsicher mit Kunst bespielt werden. Man sollte sich da zusammentun.
B.R.: Ich selbst habe lange suchen müssen, um für ein Ausstellungsprojekt Künstler zu finden, die sich in ihrer Zusammenarbeit mit Machtmonopolen in Wirtschaft und Wissenschaft nicht von diesen vereinnahmen lassen. Mir scheint dieser Aspekt in Deiner Arbeit gelungen. Wie schwer fällt es Dir, bei Deinen eigenen künstlerischen Denkmodellen zu bleiben - was führt Dich in Versuchung im Bereich der Wissenschaft?
D.M.: Als ich im MPI anfing, machte ich mir eher Sorgen, ob man mich wohl machen lassen würde, was ich vorhatte. Ich dachte, man würde mich aus Gründen der Geheimhaltung oder der Imageintegrität stärker kontrollieren, oder ich dürfe möglicherweise nicht viel anfassen, damit ich die teuren Geräte nicht kaputtmache. Oder, dass niemand Lust oder Zeit hätte, mir zu helfen und ich deshalb nicht vorankäme. Oder dass jemand sagt: na hör mal, so einen Quatsch kannst du auch zuhause machen! Das hat sich alles als Projektion meiner eigenen Ängste erwiesen, ich wartete vergeblich auf solcherart Hindernisse. Aber womit ich wirklich zu kämpfen hatte, war meine eigene Verführbarkeit im Hinblick auf die Ästhetik der technischen Welt. Die optischen Reize bringen einen ständig vom Weg ab, man verbringt Stunden mit all diesen neuartigen unendlich vielen Möglichkeiten, ohne sich entscheiden zu können. Aber sich nur damit zu befassen, das ist Dokumentation oder Illustration, wie sie in zahlreichen Fachzeitschriften bis zur Perfektion vollendet zu sehen ist. Solche Bilder bleiben auch im Kunstkontext hermetisch und kommunizieren nicht in meinem Sinne. Die optischen Reize bringen einen ständig vom Weg ab, man verbringt Stunden mit all diesen neuartigen unendlich vielen Möglichkeiten, ohne sich entscheiden zu können. Aber sich nur damit zu befassen, das ist Dokumentation oder Illustration, wie sie in zahlreichen Fachzeitschriften bis zur Perfektion vollendet zu sehen ist. Solche Bilder bleiben auch im Kunstkontext hermetisch und kommunizieren nicht in meinem Sinne.
B.R.: Was für neue Aspekte bringt Dir die Naturwissenschaft in Deinem Arbeiten? Kontrollierbarkeit, Berechnung, systematisches Vorgehen - gibt es da irgendetwas, was mittlerweile auch für dich eine Rolle spielt?
D.M.: Ich habe etwas die Furcht vor der Einfachheit verloren. Besonders die Grundlagenforschung der Physik zielt auf eine möglichst starke Reduktion der Versuchsanordnung ab. Der Physiker beschneidet sein Modell solange, bis die Versuchsanordnung formelgleiche Einfachheit erreicht hat. Er duldet nichts Überflüssiges. Zu meiner Überraschung erzeugt gerade dieses Vorgehen ein definiertes Terrain, das alle möglichen Überraschungen erst sichtbar werden lässt. Wie auf einer leeren Bühne spielen sich nun allerlei Absurditäten ab, die den Physiker dann beinahe zum Wahnsinn treiben, da natürlich nichts so passiert, wie er sich das gedacht hat. Mich beruhigte das, und ich kann mich jetzt auch in meiner Arbeit auf mehr Klarheit einlassen, ohne zu fürchten, dass sie dadurch nichtssagend wird.
B.R.: Wie sehen Deine Pläne für die Zukunft aus - was wird nach dieser Phase im Max-Planck-Institut kommen? Willst Du im Bereich der Naturwissenschaft weiterarbeiten?
D.M.: Als nächstes möchte ich endlich einen Amazonasegel zu Gesicht bekommen. Diese Tiere sind um einiges größer als die hier erhältlichen Blutegel. Der bereits erwähnte Forscher Dr. Roy T. Sawyer betreibt solch eine Zucht in Wales und weiß noch nichts davon, dass bereits ein weiterer Parasit auf dem Weg zu ihm ist.
„Transfer: Kunst Wirtschaft Wissenschaft“, Klaus Heid, Ruediger
John (Hrsg.),
Baden-Baden:[sic!], 2003, ISBN 3-933809-46-0